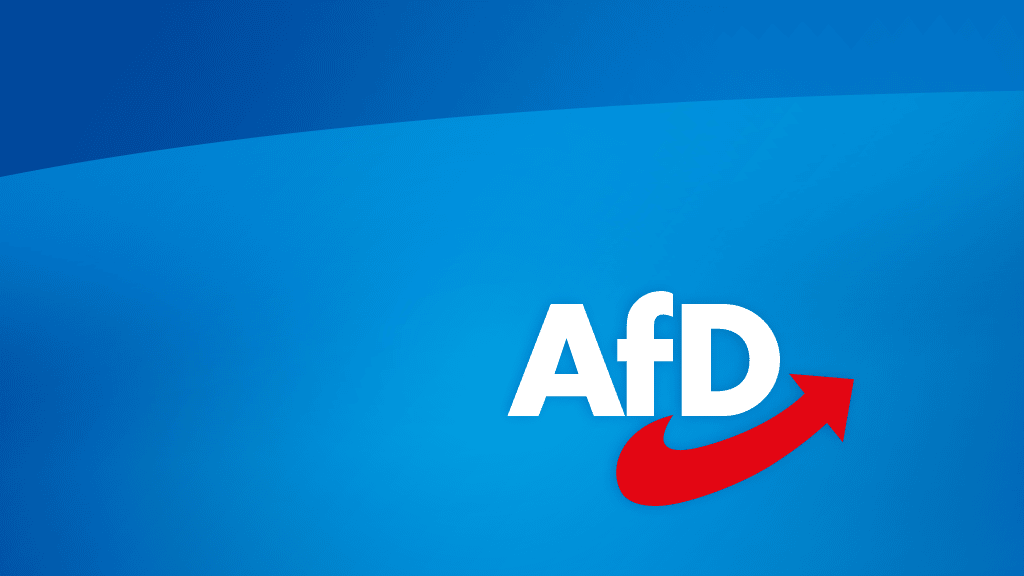«In der AfD gibt es keine Rechtsextremen»
Alexander Gauland ist einer der umstrittensten und erfolgreichsten Politiker Deutschlands. Seine Partei, die AfD, könnte bald zur zweitstärksten Kraft aufrücken. Der sensationell anmutende Aufstieg weckt Widerstand und Verunsicherung. Gauland erklärt sich im bisher ausführlichsten Interview.
Der Abdruck in Auszügen erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Weltwoche, Schweiz.
Das Interview führte Roger Köppel (Chefredakteur und Herausgeber der Weltwoche).
Es ist heiss in Berlin. Das liegt nicht nur an der Sommerhitze, die auf dieser sandigen Topfebene besonders mitleidlos brennt. Die Politik brodelt, für deutsche Verhältnisse am Siedepunkt. Seit die Alternative für Deutschland (AfD) zweistellig in den Bundestag und in die Länderparlamente eingezogen ist, schneller als seinerzeit die Grünen, schütteln Fieberkrämpfe den Betrieb. Im Grunde gibt es nur noch zwei Parteien und eine Frontlinie: Alle andern gegen die AfD.
Für die Etablierten ist die AfD das grosse Ärgernis. Man redet über die Partei wie über eine geheimnisvolle Krankheit, die von wachsenden Teilen der Wählerschaft Besitz ergriffen hat. Die Medien brüten ratlos über Therapien. Die Gereiztheit ist enorm. AfD-Abgeordnete haben Mühe, an ihren Veranstaltungen Hotelzimmer zu bekommen. Parteimitglieder müssen mit Diskriminierungen rechnen, aber nicht nur sie.
Wie viel Deutschland soll es sein?
Als die Zeit-Journalistin Mariam Lau in einem Artikel kürzlich nur schon die Frage aufwarf, ob die privaten Seenothelfer im Mittelmeer wirklich alles richtig machen, geriet sie in einen regelrechten «Shit»-Orkan aus dem juste milieu. Ein Autor des Satiremagazins Titanic wollte ihr, täglich, brühendes Wasser ins Gesicht schütten. Eine linke Kollegin meldete sich mit nicht mehr zitierfähigen Beleidigungen. Brutal ahndet der Mainstream die kleinsten Abweichungen vom korrekten Denken.
Die AfD ist das Symptom einer politischen Klimaveränderung. Früher war es im offiziellen Deutschland tabu, die EU in Frage zu stellen. Die Europäische Union bildete nach dem Zweiten Weltkrieg eine Art Vaterlandsersatz für die Deutschen. Sie war auch die natürliche politische Rückfallposition, im Zweifel für Europa. Das hat sich seit der Euro-Krise geändert, mit dem Migrationsdebakel verschärft. Auf einmal ist die EU ein Problemverursacher, und in Deutschland kommen wieder Sehnsüchte nach dem Nationalstaat auf. Für diese Sehnsüchte steht die AfD.
Es geht ans Eingemachte. Die giftigen Debatten um und gegen die «Populisten» sind Identitätsdebatten. Es gibt einen neuartigen Richtungsstreit darüber, was Deutschland eigentlich sein soll: bruchlos eingefügter Legostein im europäischen Supernationalstaat? Oder aber souveräner Nationalstaat, der sich von der problembeladenen EU löst? Vermutlich finde viele Deutschen, man brauche wieder mehr Eigenständigkeit, weil die EU so offensichtlich krankt, aber das Nationale löst aus historischen Gründen bei den gleichen Leuten auch wieder tiefsitzende Befürchtungen aus.
Die Verunsicherung ist erheblich. Wo steht die AfD in dieser Kernfrage? Wie viel Deutschland soll es sein? Wie viel Europa braucht es noch? Will man zurück in die guten alten Bismarck-Zeiten, als ob es die beiden Weltkriegsniederlagen nie gegeben hätte? Wie ist vor diesem Hintergrund das schummrige Germanengeraune einiger Mitglieder zu werten? Wird die AfD von Rechtsextremen gekapert, oder aber sind das nur Verteufelungen «systemtreuer» Medien, wie die Angefeindeten behaupten?
Wir reden über diese Fragen mit Alexander Gauland, dem Mitvorsitzenden und Mitfraktionschef der Partei. Gauland, Jahrgang 1941, ursprünglich Sachse, aber im Westen aufgewachsen, hat eine interessante Biografie. Er war jahrzehntelang Spitzenbeamter der CDU, Doktor der Rechte, angesehener Zeitungsherausgeber, Publizist und Buchautor. Zeitweise war er mein Mitarbeiter bei der Welt, ehe er dann, vor fünf Jahren, zur allgemeinen Überraschung die CDU verliess, um bei der Gründung der AfD mitzumachen.
Wir starten die Diskussion in seinem geräumigen Fraktionschef-Büro im Jakob-Kaiser-Haus, einem dieser typisch neudeutschen, historisch desinfizierten Glasgrossbauten irgendwo zwischen Privatklinik und Mausoleum, die auf den Besucher so seelenlos und steril wirken wie die Bundestagsdebatten vor dem Hereinbrechen der AfD. Nach einer guten Stunde verlegen wir uns ins gehobene In-Restaurant «Borchardt». Werden sie Gauland dort mit der Grillzange gleich wieder hinauskomplimentieren? Falsch. Wir werden ausgesprochen freundlich bedient, auch aus dem Urbanpublikum kommen keine Proteste.
Der AfD-Grandseigneur, Typus Landedelmann mit Tweed-Jacke und Manchesterhose, redet druckreif, immer unaufgeregt, fast stoisch, aber mit gelegentlichem Schalk und Charme. Er ist reflektiert, nachdenklich und reagiert offen auf Kritik. Das Alter ist ihm nicht anzumerken. Es könnte zutreffen, was ein langjähriger Kollege sagte: «Für Gauland ist die Politik ein Aphrodisiakum.» Vielleicht auch eine Verjüngungsdroge. Es folgt das wohl ausführlichste Gespräch, das Gauland, einer der umstrittensten und erfolgreichsten deutschen Politiker der Gegenwart, mit einer Zeitung je geführt hat.
Herr Gauland, starten wir mit einer aussenpolitischen Standortbestimmung. Was halten Sie von US-Präsident Donald Trump?
Ganz falsch ist der Versuch der deutschen Medien, den US-Präsidenten als Vollidioten darzustellen. Der Mann ist kein Vollidiot. Er setzt amerikanische Interessen durch, wie er sie sieht, und das macht er nicht mal ungeschickt. Ich erinnere mich an die Zeit, als schon US-Präsident Lyndon Johnson von Bundeskanzler Ludwig Erhard mehr Militärausgaben wollte. Es hat immer wieder die Kritik gegeben, die Deutschen würden zu wenig für die Verteidigung tun. Durch diese oberflächlich moralisierende Dauerkritik an Trump hat sich Deutschland blockiert, seinen Zugang zu diesem Präsidenten erschwert. Alle denken in die gleiche Richtung. Dieser Verzicht auf sachliche Analyse ist schädlich.
Er sagte, Deutschland sei der «Sklave Russlands». Man profitiere von günstigem Gas aus dem Osten, während die Amerikaner die Verteidigungsausgaben bezahlen sollten. Alles falsch?
Das ist tatsächlich Quatsch. Es muss deutsches Interesse sein, eine sichere Versorgung durch russisches Erdgas zu haben.
Wie sehen Sie den Handelskrieg gegen China und die EU?
Wir sind noch im normalen nationalen Interessengerangel, was für die Deutschen einigermassen unbegreiflich ist, weil man ihnen eingeredet hat, es gebe keine nationalen Interessen mehr, schon gar keine deutschen, höchstens europäische. Das sind Phrasen, die nur überdecken, was es immer gab: nationale Interessen und ihre kluge oder weniger kluge Durchsetzung.
Wie beurteilen Sie Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron?
Er macht genau dasselbe wie Trump, nur etwas eleganter. Klassisch französisch eben. Man ersetzt die fehlende Stärke der französischen Wirtschaft durch eine europäische Dimension, bläht sie sozusagen auf. Das war schon die Uridee bei der Gründung der EU. Die französische Interessenpolitik wurde seit dem Zweiten Weltkrieg über den europäischen Resonanzboden gespielt. Wir Deutschen machten gerne mit, weil wir so, moralisch erledigt nach der Hitler-Diktatur, als «Europäer» wieder auf die politische Bühne zurückkehren konnten.
Ist Macron ein Schaumschläger?
Das kann ich nicht beurteilen. Aber der Erfolg gibt ihm zu einem gewissen Grad recht. Er hat Reformen eingeleitet, an denen alle vorher gescheitert sind. Für die Franzosen scheint er innenpolitisch ein Gewinn zu sein. Aussenpolitisch muss man aufpassen, dass man seine Politik nicht in einem gleichsam altruistischen europäischen Wertehorizont sieht, sondern eben als eleganten Ausdruck französischer Interessen.
Ungarns Premier Viktor Orbán?
Ungarn ist ein durch den Vertrag von Trianon in einer Weise geschädigtes Land, wie es sich nicht einmal mit dem vergleichen lässt, was der Versailler Vertrag mit Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg machte. Ungarn hat rund zwei Drittel seines Staatsgebiets verloren. Es gibt tiefe historische Verletzungen. Orbán stärkt den Nationalstolz der Ungarn, indem er darauf rekurriert, dass die Ungarn einmal die europäische Abwehrfront gegen den Islam waren. Orbán sagt den Europäern: Ihr könnt gerne mehr Flüchtlinge aufnehmen, ich nehme sie nicht auf, schon gar nicht auf Geheiss von Brüssel oder Berlin, denn wir wissen, was Unterdrückung heisst. Das finde ich völlig richtig. Ob das, was er sonst noch innenpolitisch macht, richtig ist, das kann ich nicht beurteilen.
Sie loben Orbán, dabei war er 2015 ein Hauptverursacher der deutschen Migrationsmisere, als er die in Budapest gestrandeten Flüchtlinge einfach nach Deutschland abschob. Warum kritisieren Sie ihn nicht dafür?
Weil ich ihn verstehen kann. Er konnte die Migranten nur deshalb abschieben, weil Frau Merkel die Grenzkontrollen aufhob. Orbán handelte im Interesse seines Landes, und ich kann ihm keinen Vorwurf machen, dass er die Fehler der deutschen Politik ausnützte. Ich wehre mich grundsätzlich dagegen, dass wir uns ständig in die Innenpolitik anderer Länder einmischen. Wir sollten Ländern, die mit uns in der Nato sind, mehr innenpolitische Freiräume gewähren.
Wie sehen Sie Putin?
Er macht russische Interessenpolitik, und er hat enorm viel geleistet. Unter Vorgänger Jelzin bekamen die Rentner auf dem Land keine Renten mehr. Jetzt funktioniert das wieder. Putin hat einige Dinge gemacht, die dem alten russischen Traum einer europäischen Grossmacht mindestens wieder Nahrung geben. Das ist, von ihm aus gesehen, eine kluge Politik. Dass er die Krim zurückgeholt hat, was im Westen Stürme der Entrüstung auslöst, das kann mich nicht berühren. Die Krim hat nie zur Ukraine gehört, Katharina die Grosse, die Potemkinschen Dörfer, Sie kennen das. Der besoffene Chruschtschow verschenkte seinerzeit die Krim an die Ukraine, was ja sogar für die Sowjetunion eine Art Rechtsbruch bedeutete. Russland ist eben immer ein Reich geblieben, und die alte zaristische Tradition spielt noch eine grosse Rolle. Putin ist ein Vertreter dieser dem Westen völlig fremden und von ihm zutiefst abgelehnten Agenda, die wir gar nicht mehr richtig verstehen können. Russland ist aus seiner Geschichte erklärbar, und da reiht sich Putin sinnvoll ein in die Tradition russischer Grossmachtpolitik.
Geht von Putin eine konkrete Bedrohung aus?
Ob es objektiv eine Bedrohung gibt, weiss ich nicht. Subjektiv allerdings kann ich mir vorstellen, dass es in den baltischen Staaten ein Bedrohungsgefühl gibt. Ich glaube nicht, dass Putin zum Beispiel Polen wieder erobern möchte. Ich weiss allerdings nicht, inwieweit die russische Führungselite innerlich auf das Baltikum verzichtet hat. Es gibt dort, besonders in Estland, grosse russische Minderheiten. Ob Putin nun dieses Baltikum, dessen Völker ausschlaggebend waren bei der Zerstörung der Sowjetunion, zurückhaben will, da habe ich meine grossen Zweifel, aber ich kann die subjektive Furcht in einigen baltischen Staaten verstehen.
Brexit, Grossbritannien: Was ist da die entscheidende Erkenntnis?
Dass die Briten die Kontrolle zurückhaben wollen darüber, wer mit ihnen lebt, das kann ich nachvollziehen. Ob sie das erreichen, was sie sich vorstellen, da habe ich meine Zweifel. Grossbritannien alleine ist nicht mehr das Grossbritannien von Elizabeth I., das in die Welt ausgreifen konnte. Die Vorteile, die sich die Briten durch ein stärker imperiales Handeln mit Neuseeland, Australien und den USA ausmalen, treten vielleicht ein, vielleicht auch nicht.
Ihr Eindruck von Theresa May?
Wenn ich mir die Konservative Partei in ihrer Zerrissenheit vor Augen halte, dann macht sie es ganz ordentlich. Man nennt das muddling through, durchwursteln.
Sie sind ein belesener und gebildeter Mann: An welche Zeit erinnert Sie die Gegenwart? Kehren wir zurück in die Machtbalance-Politik souveräner Nationalstaaten wie im 19. Jahrhundert?
Zwischen 1815 und 1914 beherrschte Europa die Welt. China spielte keine Rolle. Das ist heute völlig anders. Aber es kehrt zurück mit aller Vorsicht eine interessengeleitete Staatenpolitik, wie es sie im 19. Jahrhundert gab. Die Phrase vom «regelbasierten Multilateralismus» kann mir ja auch kein Mensch richtig erklären. Den Glauben, dass Staaten keine Interessen haben, dass Staatenpolitik überholt ist, den habe ich nie gehabt. Aber durch die Beseitigung der Teilung der Welt in zwei festgefügte Machtblöcke entsteht nun, ohne dass man das gleichsetzen könnte, eine neue multipolare Machtordnung, wie sie von 1815 bis 1939 bestand. Und diese Machtordnung funktioniert nach zum Teil anderen Regeln als die bipolare Welt.
Kürzlich hielten Sie eine Bundestagsrede, in der Sie die Kanzlerin als Totalversagerin zum Rücktritt aufforderten. Fragen wir mal anders: Was hat Frau Merkel richtig gemacht?
Wenn Sie es am Massstab deutschen Interesses messen, dann hat sie sehr wenig richtig gemacht. Wenn Sie es am Massstab ihrer persönlichen Machterhaltung messen, hat sie eine Menge richtig gemacht, denn sie ist immer noch dran. Auch wenn sie die letzten Wahlen verloren hat, hat sie sich immer wieder durch geschickte Wendungen, die ich zum Teil völlig verfehlt finde, ihre Macht gesichert. So gesehen, ist sie als Politikerin nicht wirklich gescheitert. Wenn ich mir anschaue, was sie konkret gemacht hat, ist das für Deutschland allerdings ein Scheitern. Und da rede ich jetzt nicht nur von der Migrationspolitik. Nehmen Sie die Energiepolitik, diesen Irrsinn, der viel mehr kostet als versprochen wurde. Oder schauen Sie sich die trostlose Bundeswehr an, die Abschaffung der Wehrpflicht, die sogenannte Friedensdividende. Man ist immer dem Falschen nachgerannt, ohne nach den Alternativen zu fragen. Blättern wir weiter zurück. Da gab es eine Rede des damaligen Ministers Wolfgang Schäuble: Deutschland werde niemals für die Schulden anderer Staaten zahlen. Jetzt machen wir es ununterbrochen.
Frau Merkel hat Sie politisiert: ohne Merkel kein Gauland, keine AfD?
Der Bruchpunkt war für mich die Griechenland-Rettung und die Schamlosigkeit, mit der frühere Versprechungen weggewischt wurden unter der Überschrift «Wir müssen Europa retten». Das war damals der Moment, da auch die innere Veränderung der CDU sichtbar wurde. Ich war im sogenannten Berliner Kreis, einer Gruppe konservativer CDUler. Da gab es vor fünf Jahren ein Treffen mit dem späteren Gesundheitsminister Hermann Gröhe, der uns mitteilte: «Also bilden Sie sich nicht ein, dass Sie noch irgendeine Chance bei uns haben. Gehen Sie in Ihre Kreisverbände, arbeiten Sie dort. Dass Sie noch eine institutionelle Rolle bei uns spielen, das ist vorbei.» Das war die Haltung, man wollte diese konservative CDU gar nicht mehr: «Um Gottes willen keine kontroversen Themen!», die würden nur die Wähler der anderen mobilisieren.
Man hat Sie rausgeschmissen.
Richtig. Ich ging mit meinem Freund Konrad Adam aus dem Konrad-Adenauer-Haus raus, das Essen war übrigens sauschlecht gewesen, und ich sagte zu ihm: «Da ist nichts mehr, das war’s.» Und Adam gab mir recht. «Es ist vorbei.»
Das war der Urknall der AfD.
Ja, aber alleine hätte ich das nie geschafft. Als Nächstes rief mich Konrad Adam an, er habe einen jungen Professor kennengelernt, Bernd Lucke. Und dieser Lucke hatte eine enorme Energie. Er war der Managertyp, der ich so gar nicht bin. Wir trafen uns in Neu-Isenburg, da habe ich zum ersten Mal gedacht, «es muss eine Basis in der Bevölkerung für eine neue Partei geben.» Denn dieser Bürgersaal war übervoll. Die Leute waren zum Teil aus dem Ruhrgebiet gekommen.
Mit welchem Motiv sind Sie in die AfD eingestiegen? Man sagt Ihnen nach, es sei die gekränkte Eitelkeit gewesen nach diesem demütigenden Quasirausschmiss. Sie wollten es Merkel heimzahlen.
Dieses Motiv gab es überhaupt nicht. Ich kann der CDU doch überhaupt nichts vorwerfen. Ich habe eine sehr gute Pension, war Staatssekretär, ich habe mich nicht im Streit von diesem Amt getrennt. Ich hatte nichts gegen die CDU oder gegen Frau Merkel, ich habe die Politik für falsch gehalten.
Wie kamen Sie auf den Namen «Alternative für Deutschland»?
Anders als viele auch bei uns war ich nie ein Anhänger von Margaret Thatcher. Ihren Satz «There is no alternative» (Tina), fand ich immer eine Zumutung. Und dann kam die Merkel und sagte, zu ihrer Politik gebe es keine Alternative. So kam dieser Begriff ins Spiel.
Bleiben wir bei Frau Merkel. Hat sie es wirklich so schlecht gemacht? Es stimmt, sie führte die CDU nach links, aber warum? Weil sie mit einem Rechtskurs abgewählt worden wäre und dann die Linken an die Macht gekommen wären. Dieses grössere Übel verhinderte sie durch eine gewisse Linksverschiebung der CDU.
Das wird gesagt, aber ist es auch richtig? Ich bezweifle es. Nehmen Sie nur die Energiewende: Eigentlich gab es die schon, nur vernünftiger. Was Gerhard Schröder und Jürgen Trittin ausgehandelt hatten, war besser. Warum Merkel plötzlich alles auf den Kopf stellte, habe ich nie verstanden. In einem aber lag sie richtig, das gebe ich gerne zu: Merkel erkannte, dass die Republik nach 1968 nach links gerutscht war. Diesem Zeitgeist trug sie Rechnung. Nur habe ich nie begriffen, warum sie auf eine aktive Führung des Landes verzichtete und ihre Partei auf eine Weise ideologisch entkernte, so dass sie eigentlich zu nichts mehr zu gebrauchen ist. Was sie machte, war überschiessend, keinesfalls notwendig.
Sie erwähnten die Griechenland-Rettung. Auch hier: Ein deutscher Regierungschef muss doch alles unternehmen, um ein Auseinanderbrechen des Euro und der EU zu verhindern. Merkel wollte dieses Risiko nicht eingehen. Ist doch nachvollziehbar.
Das sehe ich anders. Griechenland hat die Wirtschaftsdaten gefälscht. Die Griechen haben sich den Beitritt mit illegalen Methoden erschlichen. Selbst ein Ureuropäer wie Wolfgang Schäuble sagte, der Euro sterbe nicht an den Griechen, man solle sie rauslassen. Ihre These ist nur dann richtig, wenn damals ernsthaft geglaubt worden wäre, dass ein Austritt der Griechen den Euro oder gar die EU zerstört hätte. Genau das aber war nicht der Fall. Man hat stattdessen die Regeln gebrochen.
Migrationspolitik: Hätten die Deutschen denn im Sommer 2015 mit Schäferhunden und Strumtruppen die europäischen Grenzen notfalls gewaltsam sichern sollen. Das zu fordern, ist vor dem Hintergrund der verheerenden Geschichte – zwei Weltkriege, Völkermord, Holocaust – schlicht weltfremd.
Nein, überhaupt nicht. Auch hier hat sie sich angezogen, was kein Mensch gefordert hat. Die Flüchtlinge sassen im Budapester Bahnhof fest. Die Kanzlerin musste sie doch nicht haben wollen. Die bayerische Polizei wäre bereitgestanden. Niemand hätte den Deutschen gesagt, sie seien wieder Nazis, nur weil sie ihre Grenzen sichern.
Merkel nahm die Flüchtlinge auf, um einen Teil der historischen deutschen Schuld zu tilgen. Der einstige Völkermörder als humanitärer Weltmeister.
Ich weiss nicht, ob Merkel darüber nachgedacht hat. Ich würde es für völlig falsch halten. Niemand sagt heute, was für ein gutes Land Deutschland sei. Und ich halte jetzt mal in aller Deutlichkeit fest: Diesen Auschwitz-Komplex können Sie nicht abstreifen, niemals, da können Sie machen, was Sie wollen.
Redet Frau Merkel eigentlich mit Ihnen?
Nein. Das interessiert sie nicht; ich würde jetzt auch den Sinn selber nicht mehr sehen.
Hat sich das Meinungsklima dank der AfD in Deutschland erweitert oder verengt?
Beides. Es wird offener geredet und diskutiert. Das haben wir hinbekommen. Gleichzeitig löste das aber einen unglaublichen Hass bei vielen aus, es gab eine Verhärtung. Im Bundestag beantworten SPD-Abgeordnete manchmal unsere Zwischenfragen nicht, mit der Begründung, Rechtsradikalen gebe man keine Antwort. Das zeigt deutlich, wie sich das Klima verändert hat: Wir sind die Guten, und das dort, die AfD, das sind die Verbrecher, das ist das Gesindel, das nicht da reingehört.
Was heisst das für die Mitgliederwerbung?
Das ist inzwischen ein echtes Problem. Es ist schon ein Problem, Hotelzimmer zu finden.
Aber in den Umfragen sind Sie im Allzeithoch.
Wir sollen es nicht übertreiben, aber wir sind bei 15 Prozent.
Sie sind gleichauf mit der Traditionspartei SPD. Werden Sie auch überschätzt?
Es ist vor allem ein massiver Verfall der SPD. Solange sich die SPD nicht klarwird, wen sie eigentlich vertritt, wird das immer schlimmer werden. Sie haben auf der einen Seite die Funktionäre, die diese ganze Willkommenspolitik mitgemacht haben, und sie haben auf der anderen Seite die Menschen, die die SPD mal vertreten hat, die Verkäuferin bei Aldi oder den Bandarbeiter bei Ford. Die sind jetzt grossenteils bei uns. Die SPD verliert, weil sie die Menschen, die wenig Geld haben, nicht mehr vertritt.
Was ist die AfD eigentlich? Partei, Bewegung, Sammelsurium, «gäriger Haufen», wie Sie einmal sagten?
Ich bleibe beim gärigen Haufen. Die Partei ist zutiefst demokratisch, leicht anarchistisch mit einer tiefen Abneigung gegen straffe Führung. Frühere Führungen sind daran gescheitert, dass Einzelne alleine ganz oben stehen wollten. Bernd Lucke wurde sofort abgewählt. Frauke Petry wollte allein Parteivorsitzende und Spitzenkandidatin sein. Die Zusammenarbeit mit mir lehnte sie ab. Diesen Alleingang wollte die Partei nicht.
Wie stabil ist die heutige Führung?
Alice Weidel, Jörg Meuthen und ich, wir verstehen uns sehr gut. Es funktioniert. Die shakespearschen Dramen sind vorbei, auch wenn es zuletzt Turbulenzen bei der AfD-Stiftung gab. Doch auch die haben wir gemeistert.
Was sind die grössten Erfolge, was die grössten Misserfolge der AfD?
Die grössten Erfolge sind, dass wir im Oktober praktisch in allen Parlamenten vertreten, dass wir zweistellig stabil angekommen sind in der politischen Landschaft und dass es uns gelungen ist, über viele Häutungen hinweg einen stabilen Markenkern in die Politik zu tragen. Die Fragen, die nicht mehr diskutiert werden durften, die werden jetzt diskutiert, zwar mit Zorn, mit Hass, aber es ist wieder möglich, Grundsatzfragen, die in Deutschland angeblich für alle Zeiten gelöst waren, anzusprechen. Das ist die grösste Leistung der AfD.
Und die Misserfolge?
Leider gehen unsere Führungswechsel immer wieder einher mit Verlusten, mit dem Versuch, Leute auszuschliessen. Frauke Petry musste sich öffentlich von uns trennen, ebenso Lucke. Wir sind noch nicht in der Lage, Führungswechsel normal demokratisch zu vollziehen, sondern sie gehen immer mit Aufwallungen einher.
Reden wir über Björn Höcke, diese Reizfigur, diesen Provokateur aus Thüringen, der immer wieder Kontroversen auslöst und in den Medien als verkappter Nazi angeprangert wird. Sie kennen und verteidigen ihn. Was hat es mit Höcke auf sich?
Höcke ist zum einen ein sehr kluger, gebildeter Mann, mit dem Sie sehr gut über historische Dinge diskutieren können. Er hat für viele Leute in der Partei, aber nicht für die Mehrheit etwas Charismatisches. Das heisst: Er erreicht Menschen über Bauch und Seele, die ich nicht erreiche . . .
. . . die Sie erreichen wollen?
Wenn ich Reden halte, dann muss ich an den Kopf appellieren. Ich bin nicht einer, der von sich aus Charisma hat. Höcke hat das. Und das führt aber auf der anderen Seite dazu, dass er Bewunderer hat, die ihn so bewundern, dass mir das manchmal zu viel wäre. Das löst dann aber auch Widerstand aus bei Leuten, die ihn für den leibhaftigen Gottseibeiuns halten. Für die einen Ekstase, für die anderen der Teufel in Menschengestalt. Beides ist töricht und ergibt dann ein unausgewogenes Bild. Wenn er vernünftig redet, ist er ein grosser Gewinn für die Partei, das grosse Zugpferd im Osten. Er hat sich in letzter Zeit sehr zurückgehalten, da habe ich mehr verbockt. Man kann ihm gar nichts vorwerfen. Deshalb ist es mir auch gelungen, mit der Unterstützung vieler Leute, das Parteiausschlussverfahren gegen ihn aufzuheben. Der Vorstand war einstimmig dafür.
Kürzlich sagte Höcke in einer grossen Rede: «Die Deutschen entscheiden sich, nicht mehr Schaf, sondern Wolf zu sein.» Das ist der Wortgebrauch eines Leitartikels von Nazi-Propagandaleiter Goebbels aus dem Jahr 1928, als er von den Deutschen als «Wolf» sprach, der in eine «Schafherde» einbricht. Darf man einem Mann, der solche Worte verwendet, politische Verantwortung übertragen?
Das sind Sprüche für seine Fans, denen er sich als unerschrockener, verlässlicher Kämpfer präsentiert. Mehr steckt nicht dahinter. Höcke gebraucht Metaphern und redet manchmal über Themen, wo auch ich sagen würde: «Das hätten wir jetzt lieber gelassen.» Er ist ein deutscher Romantiker. Er liebt sein Deutschland, heiss und innig, macht sich auch ein Deutschland zurecht, das es vermutlich schon lange nicht mehr gibt. Ja, er kann sich sehr in den Mittelpunkt stellen, ist aber sehr anständig. Niemand wird von hinten in die Brust geschossen. Mit den Formulierungen haben Sie recht.
Man wirft Ihnen vor, Sie tolerierten das nur, weil es Wählerstimmen bringt. Wo ziehen Sie die Linie des Erträglichen?
Die Frage stellt sich tatsächlich, aber die Linie wurde eben nie überschritten. Was ich in der Partei gar nicht mag: dass immer wegen irgendeines falschen Worts sofort nach Parteiausschluss gerufen wird. Da bin ich grosszügiger. Wir hatten kürzlich einen Fall, als Beatrix von Storch bei einer Messerattacke irrtümlich die Muslime beschuldigte. Sie entschuldigte sich aber und zog den Eintrag zurück. Sie sollte abgemahnt werden. Und obwohl Frau von Storch nicht meine Freundin ist, habe ich gesagt: «Hört auf, wir wollen niemand abmahnen, der sich von sich aus entschuldigt hat.» So denke ich auch bei Höcke.
Vor wenigen Wochen machten Sie selber den Höcke, als Sie die zwölf Jahre der Nazi-Diktatur als «Vogelschiss» bezeichneten. Sechs Millionen tote Juden, sechzig Millionen Kriegstote und ein Verbrecherregime, das seinesgleichen sucht – alles nur ein lästiger «Vogelschiss», den man mit einer Handbewegung abwischt? Als ich das las, dachte ich: «Welcher Vogel hat denn jetzt Gauland ins Hirn . . . ?» Sie verstehen, was ich meine.
Ich habe das wirklich nicht als Bagatellisierung verstanden, und ich hätte nie gedacht, dass das so aufgefasst wird, denn wenn Sie die ganze Rede lesen, sehen Sie, dass ich nichts verharmlost habe.
Bilder in der Politik sind wichtig, die bleiben hängen. Was wollten Sie mit dieser Rede zum Ausdruck bringen?
Ich wollte den Leuten sagen, dass es eine grosse deutschjüdische Tradition gibt, die wir verteidigen müssen. Gerade in diesem Zusammenhang war der «Vogelschiss» für mich eine Bezeichnung für tiefe Verachtung. Keineswegs eine Bagatellisierung. Und ehrlich gesagt, da ist dann auch ein Bohei darum gemacht worden. Ich habe mir mal überlegt: Mein Vater ist 1933 von den Nazis entlassen worden, weil er einen sozialdemokratischen Beamten nach dem 30. Januar noch befördert hatte. Wenn mein Vater 1933 «Vogelschiss» zu den Nazis gesagt hätte, wäre er ins KZ gekommen. 1944 wurde er verhört, weil er einige Offiziere im Umfeld des Hitlerattentats persönlich kannte. Hätte er da den Nazis «Vogelschiss» gesagt, hätten sie ihn an die Wand gestellt. Und heute soll dieses Wort ein Extremfall der Bagatellisierung sein? Da kann ich nur sagen: «Die haben sie nicht mehr alle.» Als mir jemand sagte, einen Vogelschiss könne man so leicht abwischen, habe ich sofort zugegeben: «Okay, ja, wenn man es so sieht, war es ein Fehler.»
In Ihrem Buch «Anleitung zum Konservativsein» haben Sie geschrieben, konservative Parteien müssten aufpassen, dass sie nicht von Rechtsradikalen übernommen werden. Das sei schon in der Hitlerzeit das grosse Drama gewesen. Heute kämpfen Sie selber mit diesem Problem. Wie viel Rechtsextreme gibt es in der AfD? Sind Sie selber einer geworden, ohne es zu merken?
Es gibt keine Rechtsextremen in der Partei, und ich bin sicher selber keiner.
Definieren Sie Rechtsextremismus.
Rechtsextrem heisst Führerprinzip, also Ablehnung aller demokratischen Wahlen und Ablehnung unserer staatlichen Ordnung und des Grundgesetzes. In allen Punkten können Sie der AfD gar keine Vorwürfe machen. Führerprinzip: Das gibt’s gerade bei uns überhaupt nicht. Es gibt aber den Versuch, uns in die rechtsextreme Ecke zu drängen, um uns mundtot zu machen.
Die Leute um Höcke schwelgen in der Frage: Was ist deutsch? Da wird dann mit irgendwelchen völkischen Theorien jongliert. Was bringt dieses Germanengeraune? Seit Hunderten von Jahren versuchen die Deutschen zu definieren, was deutsch ist. Geschafft hat es noch niemand. Die Deutschen waren immer schon viel zu vielfältig, um sich auf eine einengende Definition zu einigen.
Da haben Sie recht. Ich glaube auch nicht, dass es zu definieren ist.
Friedrich der Grosse nahm viele Ausländer mit Handkuss in Preussen auf, Hugenotten, Juden, Schweizer, Hauptsache, sie arbeiteten nicht für den Feind. Ist nicht genau diese Offenheit «deutsch»? Ein offener Patriotismus der Leistung?
Völlig einverstanden. Nur, es gibt eben eine neue deutsche Geschichte der Zuwanderung. Früher kamen die «Fremden» aus Kulturen, die uns zumindest ähnlich waren. Sie waren alle irgendwie Europäer und von daher sehr viel leichter integrierbar. Das stimmt eben heute nicht mehr. Für mich ist die kulturelle Verwandtschaft wichtig. Man sollte nicht massenweise Menschen aus ganz fremden Kulturen importieren. Ein Höcke würde da vielleicht weitergehen. Für ihn ist wichtig, dass einer in Deutschland geboren ist. Diese biologischen Wurzeln des Deutschtums sind für mich nicht wichtig.
Man sagt Ihnen nach, Sie seien ein Bewunderer von Bismarck. Ist Bismarck für Sie ein Leitmodell fürs 21. Jahrhundert?
Manche in unserer Partei nehmen das Bismarck-Deutschland als Referenzmodell. Ich wäre da sehr vorsichtig, weil die Innenpolitik Bismarcks in vielem falsch war. In der Aussenpolitik ist Bismarck durchaus inspirierend. Keinen vor den Kopf stossen, klug alle zusammenhalten – das war seine Aussenpolitik nach 1870. Man darf dem nicht sklavisch folgen, aber ein aufgeklärtes nationales Interesse, kein «Deutschland, Deutschland über alles»: Das ist nachahmenswert.
In Deutschland prallen heute, hoch interessant, zwei Identitäten aufeinander: Nach dem Krieg war Europa für die Deutschen der Vaterlandsersatz, die sichere politische Rückfallposition, im Zweifel für Europa. Seit einigen Jahren produziert Europa schwere Krisen. Der Aufstieg Ihrer Partei ist ein Symptom für ein wachsendes Unbehagen gegenüber der EU in Deutschland. Die AfD steht für den Wunsch nach mehr Nationalstaat. Gleichzeitig löst für viele Deutsche der Nationalstaat alte, gutbegründete Ängste aus. Wie will die AfD dieses Dilemma überwinden? Was ist Ihre Alternative zum kriselnden EU-Deutschland?
Richtig, nach dem Krieg war den Deutschen moralisch das Rückgrat gebrochen. Europa, das war das Ersatzvaterland. Auch ich war einmal sehr Europa-begeistert als junger Mann. Nur muss ich heute zur Kenntnis nehmen: Den europäischen Nationalstaat will kein europäisches Volk. Das Aufgeben meiner eigenen nationalen Identität zugunsten eines Konstruktes, das niemals Realität werden wird, weil die anderen dieses Konstrukt nicht wollen, ist kein sinnvoller Weg. Margaret Thatcher sagte: «Nur weil die Deutschen ihr Land nicht mehr lieben, müssen sie nicht allen anderen austreiben, ihr Land zu lieben.» Das Bündnis der Nationalstaaten ist in Europa das gelebte Modell, und alle Versuche von Herrn Juncker, eine Art europäische Überidentität zu schaffen, sind schon längst gescheitert.
Was also schwebt Ihnen konkret vor?
Die Europäer müssen selbstverständlich zusammenarbeiten, denn sie sind schwächer geworden im Weltmassstab. Deshalb plädiere ich für eine vernünftige Zusammenarbeit auf den Gebieten, auf denen wir es dringend brauchen. Es müssen dort auch nicht immer alle mitmachen. Ich will keine Verfestigung in einer falschen Staatsidee. Es gibt keine europäische Öffentlichkeit, keinen europäischen Demos.
Geht es der AfD um die Rückgewinnung der vollständigen nationalen Souveränität Deutschlands? Oder wollen Sie die EU mit klugen Reformen verbessern?
Da würden Sie verschiedene Antworten aus der Partei hören. Es geht um die Rückgewinnung staatlicher Souveränität, aber nur dort, wo die Vergemeinschaftung eine Katastrophe ist, Stichwort Währung, Stichwort Grenzen. Auch die Schnapsidee, eine europäische Staatsanwaltschaft einzuführen, bekämpfen wir. Daneben soll es aber eine reissfeste Zusammenarbeit geben. Der gemeinsame Markt ist eine gute Idee. In der AfD gibt es Stimmen, die da rauswollen, die auch aus der Nato rauswollen. Ich glaube, der gemeinsame Markt hat uns genützt. Aber die Überhöhung des gemeinsamen Marktes zur politischen Währungsunion war falsch. Ich möchte zurück zu den alten EWG-Positionen. Ein Nato-Austritt wäre völlig falsch. Das würde bei unseren Nachbarn Fragen aufwerfen, die wir weder beantworten können noch wollen. EU: ja, aber kein Einheitsbrei.
Personenfreizügigkeit innerhalb der EU, ja oder nein?
Ja. Wo es Missbräuche gibt, zum Beispiel die Überweisung von deutschem Kindergeld nach Rumänien, muss man dies beseitigen. Verändern, aber nicht alles zumachen.
Kommen wir zu Ihnen. Sie waren als junger CDU-Mann auf dem progressiven Flügel. Was ist seither mit Ihnen passiert?
Nichts. Früher, in den siebziger Jahren, war ich der enge Mitarbeiter des CDU-Ober-bürgermeisters in Frankfurt, einer damals sehr links geprägten Stadt. Es gab viele Sozialdemokraten in führenden Stellungen, vor allem in der Kultur. Ich riet ab, auf Konfrontation zu gehen. Nicht um mich anzupassen, aber um unsere Ziele zu erreichen. Das war eine ganz andere Aufgabe als heute die Oppositionspolitik der AfD.
Zwei interessante, äusserst gegensätzliche Figuren prägen Ihr Denken, der konservative britische Philosoph Edmund Burke und Charles-Maurice Talleyrand, der wendige Franzosen-Politiker aus der napoleonischen Zeit. Erklären Sie.
Talleyrand steht für mich für eine äusserst kluge Politik der Staatsräson. Ihm wird ja vorgeworfen, er habe mit jedem Regime paktiert, aber er hat eben nur so weit paktiert, wie das jeweilige Regime dem nationalen Interesse diente. Als Talleyrand, damals Aussenminister Napoleons, sah, dass der Kaiser ein europäisches Reich schaffen wollte, war das für ihn Grössenwahn, nicht mehr französisches Interesse. Er verriet ihn und fädelte mit dem Zaren Napoleons Sturz ein. Talleyrands Leitstern war die Staatsräson.
Edmund Burke?
Er war kein so kluger Politiker, aber er steht für mich für eine kluge Interpretation, was heute konservativ ist.
Was ist das Wesentliche?
Ein Wandel, der aber nicht begriffen wird als etwas, was um jeden Preis sein muss. Man schaut ununterbrochen: Was geht nicht mehr, was müssen wir anpassen? Darin steckt auch ein skeptisches Menschenbild. Burke war nie der Meinung, dass alle Menschen gut seien, er war auch nicht der Meinung, dass alle schlecht seien. Er fand nur, dass man die Institutionen, die man hat, nicht einfach wegrasieren soll, um alles auf einem weissen Blatt Papier neu auf-zustellen. Er forderte das, was man hat, vernünftig weiterzuentwickeln. Er sah früh, dass aus der Französischen Revolution mit ebendieser Tabula-rasa-Politik die Diktatur hervorgehen würde, die dann mit Napoleon auch kam.
Wer spricht Sie mehr an?
Talleyrand ist unübersichtlicher, Burke ist klarer. Als Figur fasziniert mich Talleyrand mehr mit seinen Wandlungen. Burke hat immer auf der richtigen Seite gestanden. Er war ein sehr moralischer Mensch, das war Talleyrand überhaupt nicht. Er aber ist die interessantere Figur, weil er in einer sehr unübersichtlichen Zeit anhand kluger Maximen die richtigen Entscheidungen getroffen hat.
Kann man die Deutschen eigentlich mit Ihrer Geschichte, mit sich selbst versöhnen?
Eine Versöhnung mit den furchtbaren zwölf Jahren schaffen Sie nicht. Sie können versuchen, zu erklären, wie es dazu gekommen ist. Ich sehe keinen Ansatz für eine Versöhnung. Sechs Millionen Juden umzubringen, das kriegen Sie nicht mehr von der Haut gekratzt. Das ist so furchtbar, und, klar, je mehr sich das historisiert, mag es schwächer werden. Aber wir stehen immer wieder vor der gleichen Frage: Wie konnte 1933 jemand ans Ruder kommen, den wir unter normalen Umständen als absoluten Schwerverbrecher wegsperren?
Wie lautet Ihre Erklärung?
Das ist nicht so schwierig. Die Niederlage im Ersten Weltkrieg ist vom deutschen Bürgertum nie verkraftet worden. Die haben sich dann geflüchtet ins Dolchstossmärchen. Aber es war eben ein Märchen, denn der angebliche Dolchstoss kam erst nach dem Entscheid der Heeresleitung, die weisse Fahne zu schwenken. Es war dann ein Riesenfehler – aber ich mache niemandem einen Vorwurf –, die Republik einzuführen, weil Deutschland im Bürgertum damals noch monarchistisch gesinnt war. Der Kaiser hatte verspielt, der Kronprinz auch. Ich hätte mir vorstellen können, dass unter dem vernünftigen Prinz Max von Baden als Reichsverweser der Kaiserenkel eine gute Rolle hätte spielen können. Das wurde versäumt. So stiess ein Bürgertum, das die Niederlage nicht verkraftet hatte, auf eine Politik, die mit dem, was war, etwas anfangen musste. Ich habe grosse Achtung vor den damaligen demokratischen Politikern und Staatsmännern, wie Rathenau und Stresemann, weil sie eine realistische bismarcksche Politik unter dem Gesetz des verlorenen Krieges versucht haben. Vielleicht wäre es gutgegangen, wenn wir keine Wirtschaftskrise gehabt hätten. In der Wirtschaftskrise war Deutschland mental nicht mehr widerstandsfähig. Und natürlich wusste 1933 niemand, dass Hitler sechs Millionen Juden umbringen wird. Der Mann ist doch nicht gewählt worden wegen seiner Verbrechen, sondern weil die Leute fälschlicherweise, zum Teil im Elend, glaubten: Wenn einer noch etwas machen kann, dann vielleicht er.
Sie sind einer der am meisten angefeindeten Politiker Deutschlands. Wie gehen Sie damit um?
Nun ja, da gewöhnt man sich dran. Ich habe einen Grossteil meiner Familie verloren, weil die sich mit mir nicht mehr sehen lassen würden. Und ich habe auch viele Freunde verloren, Gesprächspartner. Meine Tochter, evangelische Theologin, eher links, ist ganz gegen meine Politik, aber wir haben immerhin noch Kontakt, gehen gelegentlich auf Reisen.
Wie motivieren Sie sich?
Mich erbittert nur die Gesprächsverweigerung. Als ich 1977 nach Frankfurt kam, gab’s Joschka Fischer und Daniel Cohn-Bendit. Ich hatte bei meiner Anstellung zur Bedingung gemacht, dass man mich auch mit den Linken reden lasse. Ich wollte nicht, dass man mir dies verbieten würde. Auf bürgerlicher Seite waren die Vorbehalte enorm. Die Linken wollten damals die Welt umstürzen. Der Stabschef von Fischer war bei Pol Pot, das waren die schlimmsten Leute, aber ich habe immer mit denen geredet, und ich habe gerne mit denen geredet. Und ausgerechnet die kommen jetzt zu mir und sagen mir: «Mit Ihnen, mit dir können wir nicht reden.» Da sagt man sich: «Bei so viel Unvernunft ist halt nichts mehr zu machen.»
Was ist in diesem Moment Ihr wichtigstes politisches Anliegen?
Dass sich Deutschland nicht so verändert, wie das Frau Merkel offensichtlich vorhat. So wie sie die schwarzrotgoldene Fahne in die Ecke geschmissen hat, so denkt sie über dieses Land, und das entsprechende Handeln wollen wir ihr so schwer wie möglich machen.
Quelle: weltwoche.ch