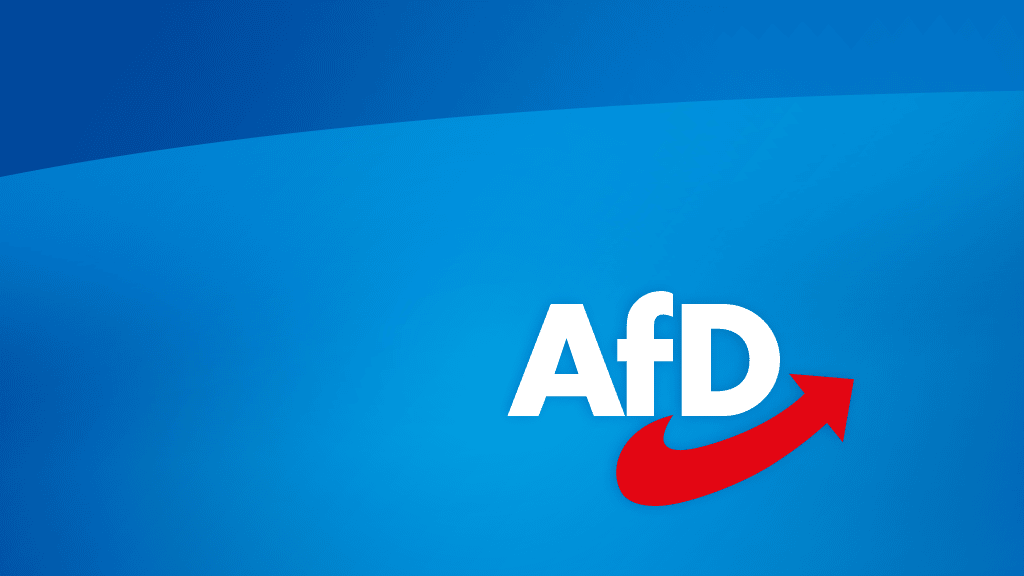Berlin, 4. April 2019. Dazu teilt Albrecht Glaser MdB, stellvertretender Bundessprecher und Vertreter in der Arbeitsgruppe Wahlrechtsreform beim Bundestagspräsidenten, mit:
„Die Reform ist daran gescheitert, dass die Interessen der Mandatsbesitzer größer waren als der Reformwille. Ziel der Reform war, die Übergröße des Parlaments abzuschaffen und die im Gesetz festgelegte Sitzzahl auch tatsächlich durch den Wahlvorgang zu erreichen. Die bisher gesetzgeberisch festgelegte Zahl der Bundestagsmandate in Höhe von 598 wurde bekanntlich 2017 um 111 Mandate überschritten.
Einigkeit bestand darin, bei einem „persönlichen Verhältniswahlrecht“ zu bleiben. Das heißt, letztlich müssen die Zweitstimmen über die Stärkeverhältnisse der Parteien im Parlament entscheiden. Unter dieser Voraussetzung, Kann eine deutliche Verkleinerung des Bundestags nur erreicht werden, wenn die Kultur der „Ausgleichs- und Überhangmandate“ beseitigt wird. Sie entstehen derzeit immer dann, wenn Parteien mehr Direktmandate in Wahlkreisen erringen, als ihnen nach dem Zweitstimmenverhältnis zustehen.
Deshalb muss bei der Zahl der Direktmandate eingegriffen werden. Das kann man erreichen, indem die Zahl der Wahlkreise stark verkleinert wird. Dies bedeutet allerdings, dass alle Wahlkreise neu geschnitten werden müssen und alle neuen Wahlkreise größer werden. Der direkt gewählte Abgeordnete wird dadurch noch weniger Nähe zum Bürger haben, wie sie heute behauptet wird.
Das war die Richtung, in der sich die Vorstellungen von FDP, LINKE und Grünen bewegten. Um auf diesem Weg die Zahl der Ausgleichs- und Überhangmandate zu vermindern, muss eine starke Reduktion der Zahl der Wahlkreise vorgenommen werden, etwa auf 250 statt bisher 298. Ausgeschlossen sind damit Ausgleich und Überhangmandate jedoch noch immer nicht. Die CDU / CSU, als bislang großer Profiteur von Überhangmandaten, wollte diesen Weg nicht mitgehen. Die AfD hat daher einen Vorschlag unterbreitet, der zielgenau eine Verkleinerung der Mandate erreicht – etwa auf 500 – und zudem sicherstellt, dass genau so viele Mandate entstehen wie vorher durch Gesetz festgelegt werden, und nichts an der bisherigen Struktur der Wahlkreise ändert. Leider wird über dieses Modell weder von den anderen Parteien öffentlich gesprochen, noch in den Medien berichtet.
Der Vorschlag ist zudem auch vergleichsweise einfach. Er sieht vor, dass wie bisher die Wahlvorschläge der Parteien über Landeslisten in den Bundesländern zur Wahl gestellt werden. Die Ergebnisse der Zweitstimme im jeweiligen Bundesland legen dann fest, wieviel Mandate jeder Partei in diesem Bundesland zustehen. Damit wird zugleich festgelegt, dass jede Partei in Anrechnung auf die Listenmandate in einem Bundesland maximal so viele Direktmandate erringen kann, wie ihr insgesamt über die Zweitstimme zustehen. Dies führt zu der Frage, wie im Einzelnen festgelegt wird, welche Direktmandate tatsächlich zum Zuge kommen und welche gegebenenfalls keine Berücksichtigung finden können, weil sie die einer Partei nach Zweitstimme zustehenden Mandatszahlen überschreiten würden.
Hierbei liegt es nahe, innerhalb des Kreises der Direktkandidaten eine Reihung zu bilden, die sich nach der Prozentzahl der im jeweiligen Wahlkreis errungenen Stimmen richtet. Das heißt, diejenigen Direktbewerber, die die relativ schlechtesten Stimmergebnisse erzielt haben, gelten als nicht in ihrem Wahlkreis gewählt und kommen damit nicht zum Zuge. Die daraus abgeleitete Folge, dass es einzelne Wahlkreise in Zukunft geben wird, die keinen Direktkandidaten in den Bundestag entsenden, ist hinzunehmen, weil dieser Nachteil dadurch überkompensiert wird, dass sowohl die Verkleinerung des Parlaments als auch die vorab exakt bestimmbare Zahl der Abgeordneten vollständig erreicht werden kann. Wer also eine Wahlrechtsreform will, welche die beschriebenen Ziele erreicht, insbesondere auch das Prinzip der Verhältniswahl nicht antasten will, muss dafür beim System der Direktkandidaten einen Preis bezahlen. Der ist allemal für die Erreichung des übergeordneten Ziels als angemessen zu bezeichnen! Dieses System hat zudem den Vorteil, dass alle Parteien gleich behandelt werden.“